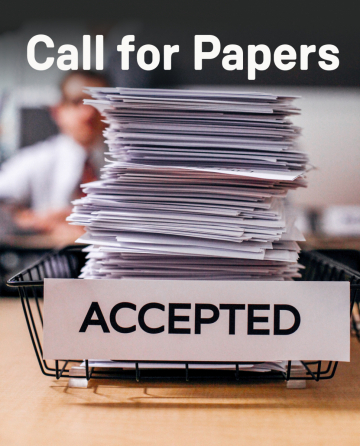Call for Papers
Die Tagung findet vom 11.- 12. Juni 2026 statt.
Das Gesundheitswesen der DDR wird bis heute als ein positives Beispiel des ostdeutschen Sozialstaates und dessen Umbau nach der Wiedervereinigung als Verlust erinnert. Lässt sich aber "Der Aufbau Ost" im Gesundheitswesen als "Nachbau West" beschreiben oder muss eher von einer "Ko-Transformation" ausgegangen werden? In einer längeren zeitlichen Perspektive, die mit den gesellschaftspolitischen Trends in den 1980er Jahren - Vermarktlichung, Ökonomisierung, Privatisierung - einsetzt und über die Wiedervereinigung von 1990 bis in die frühen 2000er Jahre hinausgeht, nimmt die Konferenz Übergänge in Medizin und Gesundheitspolitik in Ost- und Westdeutschland in den Blick.
Organisatorisches:
Übernachtungs- und Reisekosten werden von den Veranstaltern übernommen. Eine Publikation der Ergebnisse wird angestrebt.
Bitte richten Sie Ihren Themenvorschlag (max. 300 Wörter) zusammen mit einem kurzen CV bis zum 30. Januar 2026 an: medizin-im-uebergang [at] zzf-potsdam [dot] de (medizin-im-uebergang[at]zzf-potsdam[dot]de)
Veranstalter der Konferenz:
Jutta Braun, Winfried Süß, Jonathan Voges (Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, ZZF), Pierre Pfütsch (Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung), Wiebke Lisner, Heiko Stoff (Institut für Ethik, Geschichte und Philosophie der Medizin, Medizinische Hochschule Hannover)
Versanstaltungsort: Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam
Medizin im Übergang. Gesundheitspolitik im geteilten und vereinigten Deutschland von den 1980ern bis in die 2000er-Jahre
Gesundheit ist ein zentrales sozialpolitisches Handlungsfeld und zugleich ein Erfahrungsraum zahlreicher Menschen, die entweder in Gesundheitsberufen arbeiten oder aber als Patient-/innen mit dem Gesundheitswesen in Berührung kommen. Der Sozialstaat wirkt dabei durch gesundheitspolitische Entscheidungen (z.B. den Zugang zu und die Verteilung von Gesundheitsleistungen) auf die Lebensverhältnisse und das Gefüge der Gesellschaft.
Das Gesundheitswesen der DDR war ein Austragungsort des Systemwettbewerbs im "Kalten Krieg" und wird bis heute als ein positives Beispiel des ostdeutschen Sozialstaates erinnert. Lässt sich „Der Aufbau Ost“ im Gesundheitswesen jedoch vor allem als „Nachbau West“ (Steffen Mau) beschreiben? Oder gibt es Effekte einer „Ko-Transformation“ (Philip Ther), die deutlich werden, wenn eine zeitlich längere Untersuchungsperspektive eingenommen wird, die mit den gesellschaftspolitischen Trends seit den 1980er Jahren – Vermarktlichung, Ökonomisierung, Privatisierung – einsetzt und dann auch über die Wiedervereinigung von 1990 bis in die frühen 2000er Jahre hinausgeht? Inwiefern veränderten der Zusammenbruch des Kommunismus und die deutsche Einheit die Dynamik langfristiger Wandlungsprozesse der sozialpolitischen Institutionenordnung, die die Bundesrepublik durchlief?
Über welche Gestaltungsmöglichkeiten verfügten die verschiedenen Akteur-/innen im Transformationsprozess auf unterschiedlichen Ebenen der Gesundheitspolitik, wie z.B. in den Bundesländern oder in lokalen Kontexten? Welchen Beschränkungen – politischer, budgetärer und kultureller Art – waren sie unterworfen? Welchen Konzepten von (Sozial-)Staatlichkeit hingen sie an und wie stellten sie sich ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem vor? Wie wurde das Verhältnis von Staat und Markt im Gesundheitswesen austariert und in der Öffentlichkeit verhandelt, so beispielsweise im Hinblick auf die Ökonomisierung im Krankenhausbereich oder die Privatisierung der Leistungsanbieter im Stationären Bereich und im Pflegesektor?
Operationalisiert werden diese Fragen durch einen Fokus auf Konzepte, Biografien und Professionen, auf Orte und Institutionen, wobei weitere Zugriffe willkommen sind:
1. Konzepte:
Beginnend in den 1980er Jahren, verstärkt dann in den 1990er Jahren, kam es in der Bundesrepublik auch im Bereich des Gesundheitswesens zu einer „Vermarktlichung des Sozialen“ (Hockerts/Süß). Vormals staatliche Aufgaben wurden in den Bereich der Eigenvorsorge verlagert, so z.B. durch Zusatzversicherungen und durch Verantwortungsübertragung für die eigene Gesundheit an das „präventive Selbst“ (Madarasz/Lengwiler). Wie veränderte sich die Wahrnehmung von Gesundheit und Krankheit, welche Leiden bekamen neue Aufmerksamkeit, mit welchen noch unbekannten Gefahren – z.B. „Emerging and Re-Emering Infectious Diseases“ (King) – begann man sich verstärkt auseinanderzusetzen und welchen Einfluss hatte dies auf gesundheitspolitische Planungen, auf Praxen der Vorsorge sowie auf Forschungsschwerpunkte? Soziale Dienste und Infrastrukturen wurden privatisiert (allen voran die Krankenhäuser) und Marktlogiken gewannen an Bedeutung (so z. B bei der Abrechnung ärztlicher Dienstleistungen). Welche Vorstellungen eines gerechten Gesundheitssystems prägten derartige Reformvorstellungen, welche Hoffnungen und Erwartungen verbanden sich damit? Wie gestaltete sich in den 1980er Jahren der Wissenstransfer zwischen den Gesundheitssystemen in Ost und West, etwa über die Vernetzung in grenzüberschreitenden Organisationen wie der WHO? Welche Rolle spielte während der Wendezeit die „Vorsorgepolitik der DDR als positiver Traditionsstrang“ (Braun), welche Ideen zur Reform oder Bewahrung des ostdeutschen Gesundheitssystems wurden entwickelt bzw. blockiert? Weshalb galten die Polikliniken als ein positiver Erinnerungsort des DDR-Gesundheitswesens und inwiefern dienten sie als Blaupause für die 2003 eingeführten Medizinisch-Technischen Versorgungszentren (MTV)?
2. Orte – Institutionen:
Transformationsprozesse werden an Orten und in Institutionen konkret. Im Bereich des Gesundheitswesens ist hier an Ministerien, Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen, Labore, aber auch an Arztpraxen und soziale Räume zu denken. In welchen Kliniken, in welchen Organisationen oder auf welchen Kongressen trafen sich Ärzt-/innen aus Ost und West vor und nach „der Wende“? Wie veränderten sich Ausbildungen und Wissensinhalte in den medizinischen Berufen, wie Forschungsinfrastruktur und Forschungsverbünde, wie Organisation und Arbeitsalltag in Kliniken ebenso wie im Öffentlichen Gesundheitswesen von den 1980ern bis in die 2000er Jahren? Welche Faktoren entschieden darüber, ob ein Ort im Zuge der Transformation zu einem „lost place“ wurde wie das Krankenhaus Berlin Buch oder zu einem Hotspot der Transformation wie die Berliner Charité? Wie veränderten sich Entscheidungskompetenzen im gesundheitspolitischen Mehrebenensystem? Wie reagierte die Öffentlichkeit auf Reformen?
3. Biografien – Professionen:
Medizin in der Transformation wurde von Menschen erlebt und gestaltet, die im Gesundheitswesen in den verschiedenen Berufen tätig waren, z.B. als Ärzt-/innen, Krankenpfleger-/innen, Hebammen und Medizinisch-Technische Assistent-/innen; als Forschende in den Laboren und Forschungsinstitutionen, aber auch in den Verwaltungen und Ministerien. Wie erlebten sie ihren Berufsalltag und wie deuteten sie Transformationsprozesse? Welche Handlungsmöglichkeiten oder auch biografische Brüche ergaben sich für sie? Wie fügten sich DDR-Erfahrungen in die Politik, in die Ausrichtung von Forschung und die Berufsausübung ein? Ebenso ist nach Transformationsprozessen in den jeweiligen Professionen bzw. Berufsgruppen, der Organisation von Berufsvertretungen, von Verbänden und Gewerkschaften (z.B. kassenärztliche Vereinigung und Marburger Bund) sowie nach Verschiebungen von Kompetenzen zu fragen.
Kontakt
E-Mail: medizin-im-uebergang [at] zzf-potsdam [dot] de