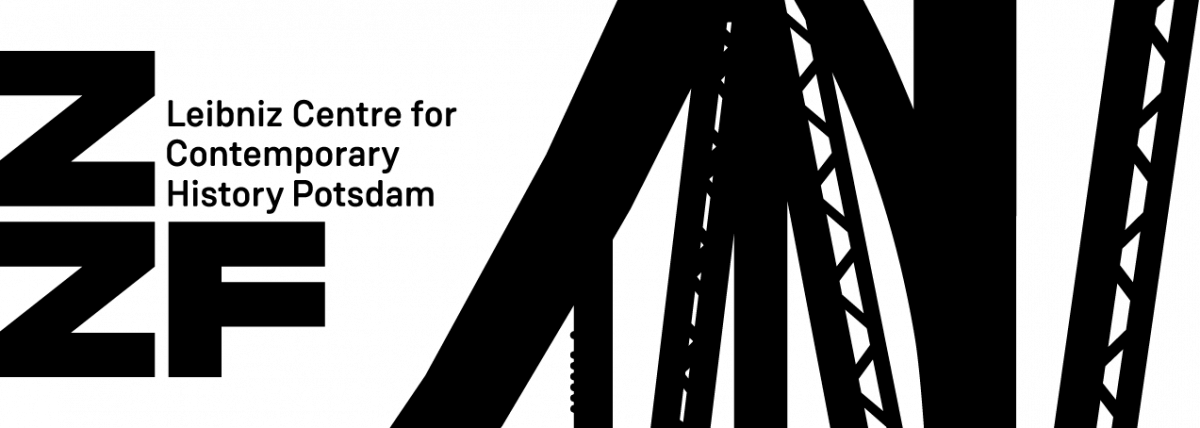Interview: »Globalisierung« als Herausforderung mit Frank Bösch
Im Rahmen unseres Jahresberichts 2020 haben wir mit ZZF-Historikerinnen und Historikern spannende Gespräche über ihre Forschungsgebiete führen können. Über das Themenfeld der "Globalisierung" als Herausforderung spricht in diesem Interview ZZF-Direktor Frank Bösch. Das Interview führte Stefanie Eisenhuth.

Bild von Free-Photos auf Pixabay
Lieber Frank, du strebst für die nächsten Jahre eine weitere Internationalisierung der zeithistorischen Forschung an. Am ZZF sollen Themenschwerpunkte aus- und neu aufgebaut werden, um die deutsche Geschichte stärker in ihren europäischen und teils auch globalen Kontexten analysieren. Schon 1998 klagte Jürgen Osterhammel, dass die außereuropäische Geschichte »ein kaum je ernstgenommenes Ornament am Rande nur der größten historischen Institute« sei. Hat sich an diesem Befund in den letzten 20 Jahren nichts geändert?
Bösch: Vorab: Es ist völlig legitim und wissenschaftlich ertragreich, sich je nach Fragestellung auch nur auf ein Land oder eine bestimmte Region zu konzentrieren, sei es auf Deutschland, Süditalien oder China. Mitunter wird die Bedeutung von Transfers in einigen Bereichen auch durch die modische Suche nach internationalen Einflüssen überschätzt. Dennoch ist die deutsche Zeitgeschichte weiterhin stark auf die Bundesrepublik und einige westliche Nachbarländer verengt, vor allem auf Großbritannien, die USA und Frankreich, so dass selbst die DDR-Forschung schon fast exotisch wirkt. Den vielfältigen internationalen Verbindungen, die gerade auch für die deutsche Zeitgeschichte charakteristisch sind, wird dies aber kaum gerecht. Diese nationale und westeuropäische Verengung ändert sich nun in den letzten Jahren: Zahlreiche neuere Projekte betten die deutsche Geschichte in größere internationale Zusammenhänge ein, die bis in den Globalen Süden reichen, andere erforschen diese aus der Perspektive außereuropäischer Regionen.
Ein Grund für die zögerliche Öffnung ist sicherlich auch die noch immer geringe Diversity in den deutschen Geschichtswissenschaften?
Bösch: Ja, in den USA oder Großbritannien sind grenzübergreifende Perspektiven weiter verbreitet, da die Diversity in der dortigen Geschichtswissenschaft deutlich größer ist. In Deutschland sind selbst Professuren und Forschungen zum Mittelmeerraum rar, wie etwa zur türkischen Geschichte, obgleich die Verbindungen dorthin sehr eng sind und viele Menschen hier türkische Sprachkompetenzen haben. Und trotz der großen spanisch- und griechischstämmigen Communities fiel im Zuge der Finanzkrise auf, dass aus der Zeitgeschichtsforschung kaum jemand etwas Fundiertes zu Griechenland oder Spanien sagen kann. Ähnlich sieht es in der zeithistorischen Forschung zum Nahen Osten aus. Offensichtlich sind die Geisteswissenschaften in Deutschland nur begrenzt offen und attraktiv für Menschen aus dem mediterranen Raum. Für Menschen mit anderen Migrationshintergründen sind die Zugangshemmnisse noch höher.
Zu dieser Exklusion kommen oft weitere, ganz praktische Fragen hinzu, die einer weiteren Internationalisierung der zeithistorischen Forschung entgegenstehen. Du hast es gerade schon angesprochen: Nicht selten fehlen entsprechende Sprachkenntnisse. Wie könnte man dieser Herausforderung begegnen?
Bösch: Anreize, auch nicht-westliche Sprachen zu erlernen, entstehen dann, wenn in der Lehre und Forschung die Relevanz von Regionen jenseits des »Westens« stärker akzentuiert wird und berufliche Aussichten für eine Arbeit in dem Bereich entstehen. Viele junge Menschen haben durchaus ein großes Interesse, sich auf andere Länder einzulassen, wie etwa die gestiegenen Auslandsaufenthalte nach dem Abitur unterstreichen.
Auslandsaufenthalte sind ein gutes Stichwort. Denn eine weitere Hürde sind oft die Kosten, da transnational oder gar global angelegte Projekte teurer sind. Man denke hier nur an die Reisekosten. Oft benötigen solche Projekte deshalb auch mehr Zeit.
Bösch: Klar, die Forschungskosten sind höher als bei einem Besuch im Berliner Bundesarchiv. Dank Videokonferenzen läuft zumindest unser internationaler Austausch nun leichter und günstiger als zuvor. Auch im Sinne ökologischer Nachhaltigkeit sollten wir auf ein »Tagungsjetset« künftig verzichten und stattdessen eher längere Forschungsaufenthalte von mehreren Monaten am Stück fördern.
Du engagierst Dich sehr dafür, dass am ZZF eine neue Abteilung entstehen kann, die sich der Globalisierung in einer geteilten Welt widmet. Was erhoffst du dir davon und wie verhält sich das zum »Markenkern« des ZZF, der deutsch-deutschen Geschichte?
Bösch: Neue Professuren und Forschungsabteilungen bilden immer einen wichtigen Nukleus, um Themen jenseits der kurzfristigen Projektlogik sichtbar zu verstetigen. Sie ermöglichen es, neue Spezialist*innen anzuziehen, die dann eigenständige Akzente setzen jenseits von eingefahrenen Bahnen. Zugleich geht es ja auch jenseits der Abteilung um den Austausch mit anderen Wissenschaftler*innen am ZZF, um wechselseitig zu lernen. Generell erscheint es mir besonders reizvoll, die am ZZF betriebene Erforschung der deutschen und internationalen Teilung Europas mit Fragen der Globalisierungsgeschichte zu verbinden. Inwieweit überlagerten weltweite Beziehungen den Kalten Krieg, und wie trugen sie zu dessen Überwindung bei? Damit wird der »Markenkern« des ZZF beibehalten, aber neu diskutiert.
In der Vergangenheit hat die Forschung am ZZF vor allem nach Osteuropa geblickt, aber auch nach Großbritannien, Frankreich oder in die USA. Was soll nun in den Blick genommen werden?
Bösch: Natürlich kann und soll das ZZF nicht mit den sogenannten »Area Studies« konkurrieren, die eine Expertise für eine bestimmte Weltregion haben und aus deren Perspektive heraus erforschen. Wir sollten eher je nach Fragestellung grenzübergreifend forschen und in die Himmelsrichtungen blicken, die themenspezifisch relevant sind. Gesellschaftlich und auch zeithistorisch wichtige Themen wie die Migration, der Welthandel oder die grenzübergreifende Digitalisierung legen ja je nach Interesse unterschiedliche Untersuchungsräume nahe. Solche Schwerpunkte sollen auch am ZZF weiter an Gewicht gewinnen. So sind bei uns in den letzten Jahren ja etwa erste Arbeiten zur deutsch-türkischen Migration, zur Computergeschichte Indiens oder auch zu deutschen Beziehung zu Togo als früherer Kolonie angelaufen, die viel Resonanz finden. Viele außereuropäische Länder wie China oder Saudi-Arabien, die offensichtlich eine besondere ökonomische und politische Relevanz in den letzten Jahrzehnten gewannen, fanden in der deutschen Zeitgeschichtsforschung bislang kaum Beachtung. Deren wachsende Bedeutung auch für Deutschland einzubeziehen, ist eine besonders schwierige, aber eben auch wichtige Aufgabe.
Diese wachsenden Einflüsse auch außereuropäischer Staaten werden gern der »Globalisierung« zugeschrieben. Der Begriff wurde erst in den 1980er-Jahren bekannter und erlebte dann einen regelrechten Boom in den 1990er-Jahren. Wenn wir den neuen Schwerpunkt mit dem Titel »Globalisierung als Herausforderung« überschreiben, übernehmen wir damit also einen jungen, zeitgenössischen Begriff zur Beschreibung der Welt. Ist da nicht Vorsicht geboten?
Bösch: Es wurde oft betont, dass das ökonomische geprägte Wort »Globalisierung« ein problematischer teleologischer Quellenbegriff sei, der deshalb zur analytischen Verwendung nicht tauge oder allenfalls im Plural zu verwenden sei. Selbstverständlich müssen wir die Begriffsgeschichte und die Wirkung der Begriffsverwendung selbst berücksichtigen und dekonstruieren – ähnlich wie bei anderen historischen Begriffen wie »Öffentlichkeit« oder »Sozialismus«. Der Begriff ist jedoch zur Beschreibung von wachsenden kultur- und grenzübergreifenden Interaktionen etabliert und längst nicht mehr auf Ökonomisches verengt. Alternative Begriffe wie »Internationalisierung« oder nur »wachsende Verflechtungen« bescheren wenige Vorteile, sind mit ähnlichen Probleme verbunden und akzentuieren nicht die neue Reichweite von Verbindungen, die wir in bestimmten historischen Phasen ausmachen können.
Die Zeitgeschichte kann also Begriffe historisieren, um vergangene Deutungen nicht einfach zu reproduzieren. Was kann sie noch, was die Sozialwissenschaften nicht können?
Bösch: Dies ist in allen Forschungsbereichen der Zeitgeschichte eine zentrale Herausforderung. Die Zeitgeschichte muss eigenständige Fragen und Methoden entwickeln und darf neben Begriffen auch Statistiken oder Selbstbeschreibungen eben nicht einfach übernehmen. Um eine andere Lesart zu ermöglichen als sozialwissenschaftliche Arbeiten, die oft aus der Vogelperspektive mit größere Datensätzen gearbeitet haben, entstehen ja vor allem akteursbezogene, eher mikrogeschichtliche Studien zu einzelnen Unternehmen, sozialen Gruppen oder Problemen. Wie in anderen Bereichen auch, werden wir die Rohdaten von früheren Studien betrachten und die Sozialwissenschaftler*innen in dem jeweiligen Feld selbst als Akteure historisieren, um ihren Einfluss auf Entwicklungen auszumachen.
Die historische Forschung unterscheidet eine erste und eine zweite Globalisierung. Warum ist das so und worin unterscheiden sich die erste und die zweite Phase?
Bösch: Üblicherweise werden die intensivierten internationalen Interaktionen seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts denen seit den 1970er-Jahren gegenübergestellt. Zwischendrin, nach dem Ersten Weltkrieg, haben diese abgenommen. Gemeinsam ist beiden Phasen, dass der zunehmende und erleichterte internationale Handel als Indikator gilt, zudem das Entstehen neuer kommunikativer Verbindungen – von der Telegraphie über das Telefon bis zum Internet – oder auch das Aushandeln globaler Normen und Regeln. Differenzen bestehen sicherlich in der Rolle der gewaltsamen Durchsetzung der Globalisierung im Kolonialismus, wenngleich auch in der Zeitgeschichte brutale Kriege neue internationale Verbindungen schufen. Mir erscheint es wichtig, nicht allein die Geschichte seit den 1970er-Jahren zu fokussieren, sondern längere Austauschbeziehungen in den Blick zu nehmen und zu fragen, inwieweit diese Pfade begründeten: Handelsbeziehungen knüpfen etwa oft an ältere Traditionen an, neue Medien wie das Fernsehen folgen Infrastrukturen wie der Telegraphie und dem Radio.
Dein neues Buchprojekt widmet sich der Frage nach dem Umgang der Bundesrepublik mit weltweiten diktatorisch verfassten Staaten. Was reizt dich an diesem Thema?
Bösch: Das ist vor allem der Versuch, eine andere, eine eher globale Nachgeschichte des Nationalsozialismus zu schreiben. Die Bundesrepublik suchte ja durch ihre starke Exportorientierung nach 1945 schnell einen engeren Austausch mit Staaten in aller Welt. Auch, um in der Systemkonkurrenz politische Anerkennung zu finden. Oft waren dies Autokratien und Diktaturen. Ausgerechnet in den 1970er-Jahren, als die Demokratisierung in der Bundesrepublik an Gewicht gewann, nahm ihre weltweite Interaktion mit Diktaturen zu – von Südkorea und China über viele arabische Staaten bis hin nach Argentinien. Mich interessiert besonders die Frage, wie Deutsche nach dem Nationalsozialismus mit antikommunistischen Staaten umgingen, die politische Gegner verfolgten und folterten.
Funktionierte der Antikommunismus nicht gerade als verbindendes Element?
Bösch: In den 1950er-Jahren noch. Interessant ist, wie seit den 1960er-Jahren schrittweise auch anti-kommunistische Autokratien zu den neuen Feindbildern wurden und breite Proteste gegen neue Militärdiktaturen wie in Griechenland, Südkorea und Chile das alte Blockdenken herausforderten. Hier lässt sich zeigen, wie das einst antikommunistische Eintreten für Menschenrechte in der DDR nun auf andere Länder übertragen wurde.
Welche Akteur*innen willst Du in den Blick nehmen? Geht es Dir um politische Beziehungen im Sinne der Diplomatiegeschichte oder wird es eher eine Transfergeschichte »von unten«?
Bösch: Unterschiedlich. Neben dem Agieren von Politikern und Unternehmen betrachte ich etwa die Rolle von Migranten, von NGOs wie Amnesty International, investigativen Journalisten oder von Protestbewegungen. Ein Kernfrage ist, welche Impulse »von unten« politische Reaktionen prägten, die, wie ich zeigen kann, tatsächlich oft Auswirkungen hatten. Die Akteur*innen bewegen sich im Spannungsverhältnis zwischen ökonomischen Interessen, der Suche nach politischer Akzeptanz und dem Bemühen, für Menschenrechte und Demokratie einzutreten, und diese Ziele decken sich natürlich oft nicht.
In nicht wenigen Fällen sind die Archive jener Länder, die hier zur Debatte stünden, noch immer nicht frei zugänglich. Wie können Historiker*innen diesem Problem begegnen?
Bösch: Natürlich können wir in China oder Iran nicht frei in Archive spazieren, und selbst für Russland wird dies immer problematischer. Aber generell gilt: Ein interessantes, wissenschaftlich und gesellschaftlich relevantes Thema sollte nicht ausgeblendet werden, weil der Quellenzugang schwierig ist. Viele Globalhistoriker*innen arbeiten, auch wegen Sprachgrenzen, vor allem mit Sekundärliteratur und gedruckten Quellen, was ich nicht glücklich finde. Vielmehr sollten wir uns bemühen, kreativ Zeugnisse zu sammeln: Sei es durch Zeitzeugen-Gespräche, auch mit Reisenden und Exilant*innen, öffentlich zugängliche Quellen, Zeugnisse aus der Bevölkerung oder Parallel-Überlieferungen aus anderen Ländern.
Kannst Du ein konkretes Beispiel nennen?
Bösch: Ich selbst, der ich nun eher zur deutschen Geschichte in globalen Kontexten forsche, habe etwa oft mit Zeugnissen gearbeitet, die Reisende, Migrant*innen oder auch Botschaften in schwer zugänglichen autokratischen Staaten gesammelt und übersetzt haben. Hier finden sich ansonsten kaum überlieferte Dokumente wie oppositionelle Wandzeitungen aus China oder vertrauliche Gespräche mit Geheimdiensten in Diktaturen wie Südkorea oder Iran. Botschaften, Unternehmen oder NGOs wie Amnesty haben meist Vertrauenspersonen in diesen Staaten, die nur mündlich und anonym verfasste Berichte überliefern.
Besteht hier nicht die Gefahr, nur eine Außenperspektive einnehmen zu können? Wie gehst Du damit um, dass sich – um bei dem Beispiel zu bleiben – die Verfasser*innen der Wandzeitung oder die von den Geheimdiensten Bespitzelten sich nicht ermitteln und befragen lassen?
Bösch: Natürlich haben Historiker*innen der »Area Studies« und aus den Staaten mit unzugänglichen Archiven auch mit Interviews gearbeitet, mit grauer Literatur oder eben der Staatspresse. An Verfolgte aus den 1950er- und 1960er-Jahren wird man sich so nicht direkt annähern können, sondern muss sich hier auf Quellen von Beobachter*innen vor Ort verlassen. Leider erschwert COVID-19 diese Forschungen vor Ort gerade immens, so mussten auch unsere Doktorand*innen ihre entsprechenden Reisen nach Iran oder Togo absagen.
Lass uns zum Abschluss noch einen Sprung in die Gegenwart wagen. Seit Beginn der Corona-Pandemie mehren sich die Stimmen, die auch langfristig eine erneute Abschottung der Nationalstaaten befürchten. Die temporär geschlossenen Grenzen sind für sie ein Symbol dafür. Erleben wir den Beginn einer rapiden De-Globalisierung?
Bösch: Die Ausbreitung von COVID-19 ist, genau wie Trumps Handelsstreit mit China, gerade ein Ausdruck der Globalisierung. In welche Richtung sich dies unter Joe Biden und nach den Impfungen ab 2022 entwickeln wird, ist wie immer in der Geschichte offen, so dass man mit Prognosen wie »DeGlobalisierung« vorsichtig sein sollte. Gerade der Blick auf Globalisierungsprozesse unterstreicht diese Offenheit internationaler Vernetzungen, wie etwa die Abnahme von internationalen Austauschformen nach dem Ersten Weltkrieg. Vorerst erscheint es mir jedoch unwahrscheinlich, dass sich etwa die digitale Kommunikation künftig national verengt, die Migration aufhört oder der weltweite Handel an Bedeutung verliert.